Das Geheimnis der Habituation: Warum Übergewicht ein Vorteil sein kann
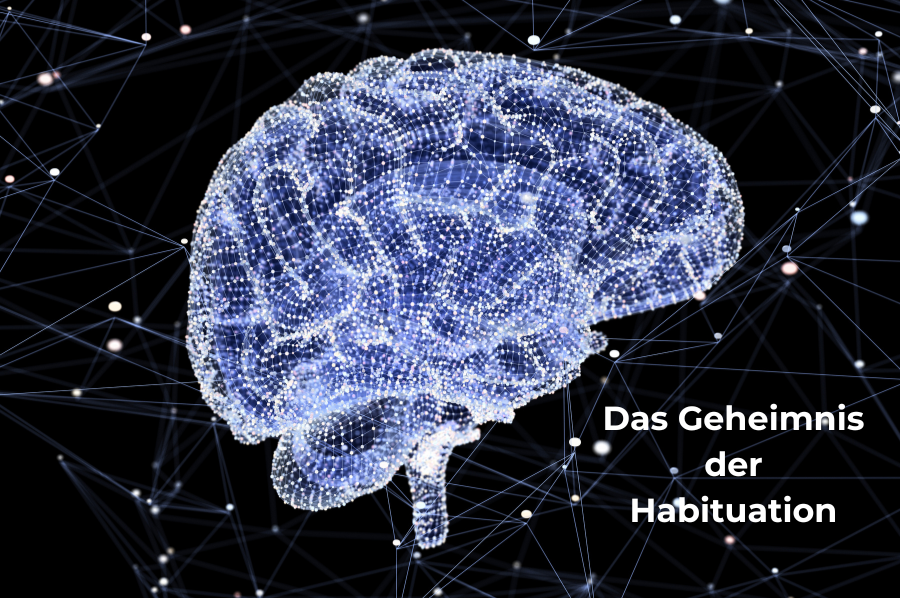
Das Geheimnis der Habituation: Warum Übergewicht ein Vorteil sein kann
Habituation und Übergewicht: darum geht es in diesem besonderen Beitrag unseres Stammgastautors Gnubbel. Mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Tiefgang, Klarheit und feinem Humor beleuchtet er ein Thema, das viele bewegt:
Warum Übergewicht nicht unbedingt ein Nachteil sein muss – und was das geheimnisvolle Prinzip der Habituation damit zu tun hat:
„Hundert Kilo abgenommen und immer noch kein Gramm leichter!“ – das kann doch jeder, der mit seinem Körpergewicht unzufrieden ist, blind unterschreiben, oder nicht? Da kämpft man verbissen gegen seine Pfunde, zieht eine Diät nach der anderen durch, versagt sich jede kleine Gaumenfreude, schwitzt sich Abend für Abend auf dem Laufband die Seele aus dem Leib – und wenn man seinem Körper mal ein paar Kilo abgetrotzt hat, sind sie spätestens nächste Woche wieder drauf, mit Zinsen. Aber zehn Kilo gute Laune, die sind garantiert weg.
Warum funktioniert das nicht? Liegt das wirklich nur am fehlenden Willen? Nun, wenn man alles versucht und nichts erreicht hat, sollte man sich doch einmal die Frage stellen, ob man mit Nahrungsrestriktion und Laufbandtraining nicht aufs falsche Pferd gesetzt hat. Oder anders ausgedrückt, ob das Körpergewicht überhaupt von der Anzahl der aufgenommenen oder ausgeschwitzten Kalorien abhängig ist.
Es gab da mal ein Experiment in einem amerikanischen Gefängnis, da hatte man allen Insassen, die es innerhalb von drei Monaten schaffen würden, ihr Körpergewicht um ein Viertel zu steigern, die Entlassung versprochen. Nun ist ja bekanntlich Zunehmen kein Problem, also fraßen die Häftlinge drei Monate lang wie die Scheunendrescher. Erfolgsquote: null! Nicht einer hatʼs geschafft. Wie konnte das sein? Es ist schwer zu glauben, aber die Freude auf die baldige Entlassung hatte ihr Vorhaben sabotiert. Grund genug, sich einmal näher mit dem Einfluss des Seelenlebens auf das Körpergewicht zu befassen.
Habituation: Was steckt hinter dem Begriff?
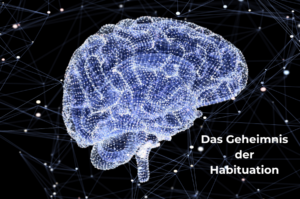
Habituation und Übergewicht
Die Begriffe „Frustfressen“ und „Kummerspeck“ sind ja allgemein geläufig und werden von den nicht Betroffenen gerne als „billige Ausrede“ derjenigen, die nicht mit einem Waschbrettbauch bzw. einer Bikinifigur gesegnet sind, abgetan. Dabei sind diese beiden Begriffe viel näher an der Wahrheit dran, als man glauben möchte. Wenn man sich nämlich einmal jenseits von stupidem Fatshaming die Mühe macht, etwas tiefer zu graben, um herauszufinden, was Stress und Übergewicht wirklich miteinander zu tun haben, so stößt man irgendwann auf den Begriff „Habituation“. Dieses Fremdwort könnte man grob mit „Gewöhnung“ übersetzen, was aber die grundlegenden Zusammenhänge nicht erklären kann. Passender wäre daher der etwas sperrigere Begriff „unbewusst erlernte Verhaltensunterdrückung“. Den Unterschied möchte ich einmal am alltäglichen Beispiel des Lärms beleuchten.
Warum man sich an Lärm nicht gewöhnen kann
Menschen, die an einer stark frequentierten Straße wohnen, werden es kennen: In der ersten Zeit wacht man von jedem vorbeifahrenden Auto auf. Das einschlägig noch unerfahrene Gehirn wertet den Straßenlärm unbewusst als Gefahr und reagiert mit erhöhter Aufmerksamkeit. Aber da das Gehirn lernfähig ist, macht es mit der Zeit die Erfahrung, dass von dem Straßenlärm keine Gefahr ausgeht, und irgendwann kann man sogar bei offenem Fenster schlafen und wacht nicht einmal mehr auf, wenn draußen ein LKW vorbeidonnert. Die Schlussfolgerung liegt also nahe, dass man sich an die ständige Lärmbelastung gewöhnen kann.
Dass dem nicht so ist, erfährt man einige Stunden später, wenn man durch das zarte Piepsen des Weckers aus dem Schlaf fährt. Wie kann das sein: Der Straßenlärm lässt uns beruhigt weiterschlafen, während uns das Piepsen des Weckers aus dem Schlaf reißt? Nun, genau das ist Habituation: ein ständiges unbewusstes Abwägen und Aussortieren der unwichtigen Schallquellen von jenen, die erhöhte Aufmerksamkeit erfordern. Und dieser Filtervorgang lässt das Unterbewusstsein Nacht für Nacht Unmengen an Energie verbrauchen.
Wie das Gehirn durch Habituation seine eigene Energieversorgung sabotiert …
Und damit haben wir das nächste Problem: Da das Gehirn den Stressor Straßenlärm herausfiltert und damit seine eigene Stressreaktion, die es auf direktem Weg mit zusätzlicher Glukose versorgen soll, unterdrückt, hat es sich quasi selbst ein Bein gestellt und kann sich die enormen Energiemengen, die es für das permanente Filtern benötigt, nun nicht mehr selbst beschaffen. Es ist also darauf angewiesen, vom Körper mitversorgt zu werden. Und während sich das Gehirn über die Stressreaktion bedarfsgerecht versorgen konnte, geht es jetzt nur noch, indem der Körper einen Überschuss an Nährstoffen bereitstellt, von dem er einen großen Teil wieder zurückbekommt und in den Fettzellen einlagert (warum das so ist, kann man hier nachlesen).
Kurz gesagt: Straßenlärm macht dick, das hat sich im Rahmen der NAKO Gesundheitsstudie eindrucksvoll bestätigt – und hätten die Studienbetreiber das Phänomen der Habituation auf dem Schirm gehabt, hätten sie sogar den Grund dafür nennen können. Und dann würde womöglich auch ersichtlich werden, welchen Sinn es macht, die Verkehrsinfrastruktur in den Städten so zurückzubauen, dass zwar der Durchgangsverkehr hinausgedrängt wird, aber Anwohner, Besucher und Lieferanten, die auf Mobilität angewiesen sind, massiv unter Stress gesetzt werden, zumal wenn der Verkehrslärm dann durch den Lärm von Rasenmähern und Laubbläsern ersetzt wird.
… und uns damit zwingt zu essen
Nun ist aber der Lärm nur einer von unzähligen Stressoren, mit denen wir uns tagein, tagaus das Leben schwer machen. Aber alle funktionieren nach dem gleichen Muster: Das Unterbewusstsein lernt mit der Zeit, die unnützen Störfaktoren immer besser auszufiltern, sodass die Stressreaktion mehr und mehr erlahmt und die Energieversorgung des schwer arbeitenden Gehirns nun extern erfolgen muss, nämlich durch den nächtlichen Gang zum Kühlschrank.
„Sie essen, um sich zu trösten“, heißt es dann mitfühlend – gerade so, als ob man jederzeit damit aufhören könnte, sein gestresstes Gehirn mit dem dringend benötigten Nachschlag an Energie zu versorgen. Nein, das Gehirn hat wirklich extremen Hunger und braucht diese Extraportion zum Funktionieren. Und wenn man ihm diese Nahrung verweigert, dann zweigt es sich die Energie eben aus den Muskeln ab, und wenn man dann schon morgens unter einer Betonplatte aufwacht und den ganzen Tag durch eine Teergrube watet, heißt es nur: „Beweg dich mehr!“
Habituation heißt nicht, ob, sondern wo wir dick werden
Die schlechte Nachricht ist also: Habituation macht dick. Die gute Nachricht: Wir können uns aussuchen, wo wir dick werden und welche gesundheitlichen Folgen das hat. Der Dreh- und Angelpunkt dafür sind die Mitochondrien in unseren Leberzellen. Diese ernähren sich von den Bruchstücken der Fettsäuren, die sie aus der Nahrung oder aus den Fettzellen bekommen, und setzen sie teilweise wieder zu Fettsäuren zusammen, und teilweise oxidieren sie sie zu Ketonen. Das Verhältnis der beiden Produkte zueinander hängt wiederum davon ab, wie viel Insulin dabei zugegen ist: Wenn wir viel Insulin im Blut haben, werden mehr Fettsäuren produziert, bei weniger Insulin mehr Ketonkörper. Glücklicherweise haben wir aber, wenn wir nicht gerade an Diabetes Typ 1 leiden, immer genug Insulin im Blut, dass die Anzahl der Ketonkörper begrenzt ist und wir nicht Gefahr laufen, in eine Ketoazidose abzurutschen, die unser Blut übersäuern und damit unseren ganzen Stoffwechsel aushebeln würde.
Damit haben wir es in der Hand: Ernähren wir uns kohlenhydratreich, haben wir viel Insulin im Blut, sodass vermehrt Fettsäuren produziert werden, die letzten Endes, da ja auch genug Glukose im Blut ist, in unserem Unterhautfettgewebe landen, sodass wir rundherum dick werden. Minimieren wir hingegen die Kohlenhydrate, muss dass Gehirn auf Ketonkörper ausweichen. Und damit immer genug davon da sind, legt das Stresshormon Cortisol im Bauchbereich Fettzellen an, damit sich die Mitochondrien in den Leberzellen auf kurzem Weg an dem begehrten Rohstoff bedienen können. Da ist es nur logisch: Je mehr wir unter Dauerstress stehen, umso mehr Ketonkörper braucht unser Gehirn, und umso größer werden daher die Fettreserven in unserem Bauch sein.
Warum die Fähigkeit zur Habituation ein großer Vorteil ist
Bei dieser Auswahl zwischen Pest und Cholera wirkt es geradezu zynisch, zu sagen, dass dies ein Glücksfall ist, aber es ist die Wahrheit: Das Körperfett ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Dies kann man an jenem Viertel der Menschen erkennen, das nicht habituieren kann. Das sind die Menschen, die sich jedesmal von Neuem an denselben Missständen abarbeiten, dabei eine ungebremste Stressreaktion zeigen und sich somit an Leib und Seele verschleißen, weil es ihnen einfach nicht gelingt, die Stressoren auszufiltern. Die bleiben, da ihr Gehirn sich die benötigten Nährstoffe nach wie vor bedarfsgerecht aus dem Körper herausziehen kann, gertenschlank, entwickeln aber oft schon frühzeitig einen Diabetes oder sterben mit Mitte fünfzig an der „Managerkrankheit“ Herzinfarkt (das sind die Stressfolgen, auf die die NAKO Gesundheitsstudie ebenfalls hinweist, aber irrtümlich am Übergewicht festmacht). Diese Menschen sind nicht zu beneiden, denn die Fähigkeit zur Habituation ist genetisch festgelegt, man hat sie oder man hat sie nicht.
Warum Kalorienreduktion den Vorteil der Habituation zunichte macht
Aber es gibt einen Stressor, der nicht ausgefiltert werden kann, bei dem uns unsere Fähigkeit zu habituieren nichts nützt, und das ist Energiemangel im Gehirn. Der ist eine existenzielle Gefahr und wird mit einer entsprechend heftigen Stressreaktion beantwortet. Wenn wir also versuchen, unser Übergewicht zu bekämpfen, indem wir unseren Körper aushungern, dann schlagen wir den Sack, um den Esel zu treffen, denn letzten Endes wird das Gehirn, das ganz am Ende der Lieferkette sitzt, immer das Nachsehen haben. Dann wird es gezwungen sein, mithilfe seiner Folterwerkzeuge die Energie in Form von Proteinen aus Muskeln, Gelenken, Bindegewebe und Immunsystem zu holen, und damit machen wir den Vorteil, den uns die Natur zum Preis des höheren Körpergewichts bietet, wieder zunichte. Dann werden wir genau die gleichen Symptome entwickeln wie die Menschen, die nicht habituieren können: Diabetes, Schlaganfall, Herzinfarkt und ein zerstörtes Immunsystem bis hin zum Krebs. Und die Ärzte werden wieder einmal sagen: Daran ist nur das Übergewicht schuld. Wir aber wissen jetzt: Nein, es ist der ständige Kampf gegen das „Übergewicht“, der weltweit verheerende Schäden anrichtet und der auch die Sängerin Cass Elliot als ein prominentes Beispiel bereits mit 34 Jahren das Leben gekostet hat.
Hinzu kommt noch, dass wir mit der Nahrungsrestriktion die Mitochondrien, die kleinen Kraftwerke in den Zellen, die den Energieträger ATP produzieren, ebenfalls aushungern und dezimieren, und damit wird nicht nur die Bereitstellung der Nährstoffe, sondern auch die Energieproduktion im Gehirn selbst problematisch. Die Folge ist, dass wir uns zunehmend müde, schlapp und gestresst fühlen, und am Ende wartet der Burnout. Ein Grund mehr, mit diesem Unsinn endlich aufzuhören.
Nicht die Habituation bekämpfen, sondern deren Ursachen beseitigen
So kann eben ein vermeintliches Unglück auch ein Glück sein, das uns vor dem Schlimmsten bewahrt. Und dafür wiederum braucht man nicht einmal zu habituieren, man kann den Stressor „Ich bin zu dick!“ auch komplett ausschalten, indem man sich einfach so annimmt, wie man ist, sich darüber freut, zu den von der Natur Bevorteilten zu gehören, bei denen der Stress auf Bauch und Hüften umgeleitet wird, wo er keinen Schaden mehr anrichtet, und die Fatshamer in die Wüste schickt. Dieses Prinzip ist in der Psychologie als Akzeptanzbereich bekannt, also wie weit die Realität von den eigenen Erwartungen abweichen darf, ohne dass sie in uns eine Stressreaktion provoziert. Hier liegt es an uns, an unseren Erwartungen zu arbeiten und durch bewusstes Lernen unseren Akzeptanzbereich so zu vergrößern, dass unser „Übergewicht“ und auch viele andere Abweichungen von unseren Erwartungen uns nicht mehr den Seelenfrieden rauben können.
Oder man macht sich auf die Suche nach seinen Stressoren und beseitigt sie oder entfernt sich aus ihrem Wirkungsbereich (zum Beispiel indem man in eine ruhige Gegend umzieht – oder seinen Fernseher entsorgt und dafür ein paar gute Bücher liest). Dann kann man auch mit einem geringeren Akzeptanzbereich ein „gutes Leben“ ohne toxischen Stress führen und seiner Gesundheit damit einen unschätzbaren Dienst erweisen.
Wie sich das Körpergewicht von selbst reguliert
Und was die Habituation angeht, so wird sich gegebenenfalls mit etwas Geduld meist eine Spontanerholung einstellen, und man bleibt bzw. wird schlank, ohne gesundheitlichen Schaden zu nehmen (diese Erfahrung kann man oft bereits in den drei Wochen seines Urlaubs machen, wo man es sich so richtig gut gehen lässt und trotzdem – nein, gerade deswegen – abnimmt). Dass das in unserem gesellschaftlichen Umfeld allerdings nicht ohne weiteres realisierbar ist, sieht man einerseits am verbreiteten „Übergewicht“, aber andererseits auch an den ausufernden „Zivilisationskrankheiten“, was jedoch in erster Linie für die Unfähigkeit bzw. Unwilligkeit der Gesellschaft spricht, sich einmal ernsthaft mit deren wahren Ursachen zu befassen, die ich mir auch nicht aus den Fingern gesaugt habe, sondern die in Fachkreisen wohlbekannt sind und deren Kommunikation in der Öffentlichkeit leider sehr zu wünschen übrig lässt. Deshalb geht, wenn wir unsere Gesundheit erhalten wollen, kein Weg daran vorbei, dieses Thema selbst in die Hand zu nehmen und uns die Informationen zu beschaffen, die wir dafür brauchen und die uns niemand auf dem silbernen Tablett reicht.
Über den Autor Gnubbel:
Gnubbel, unser geschätzter Stammgastautor, begeistert immer wieder mit seiner besonderen Sicht auf scheinbar bekannte Themen. Seine Texte sind tiefgründig, hinterfragen gängige Denkmuster und regen dazu an, die eigene Perspektive zu erweitern.
Wir danken Gnubbel herzlich für diesen wertvollen Beitrag und freuen uns schon jetzt auf die nächste spannende Geschichte aus seiner Feder.
Die LCHF Deutschland Akademie – mit Herz und Verstand
Seit 2015 bildet die LCHF Deutschland Akademie aus und durfte viele Menschen auf ihrem Weg zum Coach begleiten.
Für wen ist die Ausbildung zum Gesundheits- und Ernährungscoach geeignet?
Begeisterte AbsolventInnen zwischen 18 und 70 Jahren, SchülerInnen, Mütter, JuristInnen, PädagogInnen, PhysiotherapeutInnen, FitnesstrainerInnen, HeilpraktikerInnen, GesundheitspflegerInnen, KonditormeisterInnen, Kaufleute aus den verschiedensten Bereichen…
Also für Menschen jeglichen Alters mit und gänzlich ohne Vorkenntnisse.
Was sie alle vereint ist das Interesse an ganzheitlicher Gesundheit. Das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele. Der Wunsch, fachlich fundierte Kenntnisse im Gesundheits- und Ernährungsbereich erlangen zu wollen, basierend auf den neuesten wissenschaftlichen Ergebnissen und Erfahrungen.
Für ihre eigene Gesundheit, die ihrer Familie, oder um anderen Menschen zu einem gesünderen Leben zu verhelfen.
All diese Menschen unterschiedlichen Alters und aus den verschiedensten Bereichen zeigen, es ist nie zu spät dazuzulernen und neu anzufangen!
Wann dürfen wir dich in der LCHF Deutschland Akademie begrüßen?
Neuigkeiten
Du möchtest das Neueste aus dem Bereich Gesundheit und Ernährung erfahren? Prima, dann abonniere unseren Newsletter.
Dein LCHF Deutschland Team
LCHF-Deutschland und LCHF Deutschland Akademie, Facebook, Instagram und YouTube




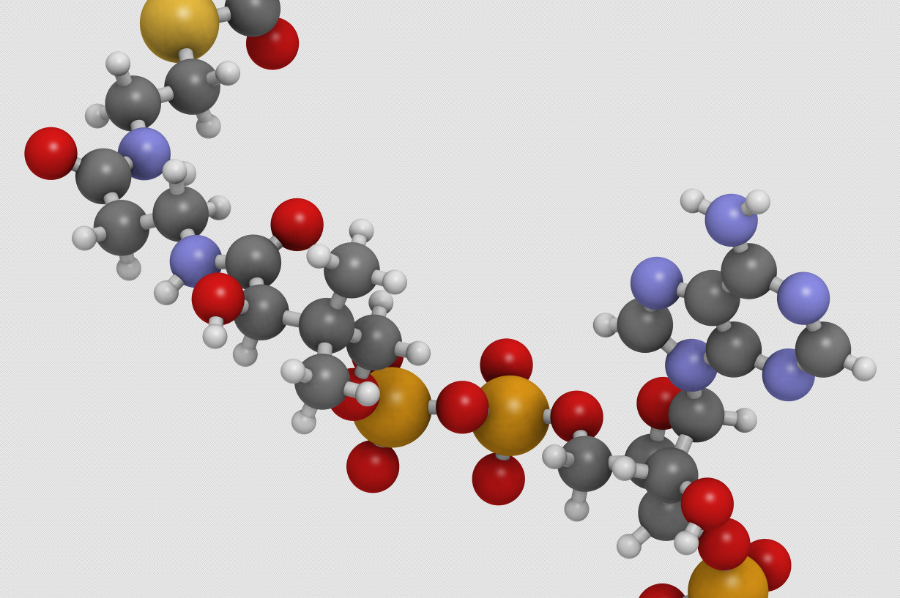


Margret Ache 28. Oktober 2025
Lieber Gnubbel,
du hast es wieder geschafft – mit Witz, Tiefe und einer Prise Provokation den Finger genau in die Wunde zu legen!
Dein Text ist ein Augenöffner: Habituation als biologischer Schutzmechanismus statt als „Faulheit“ – das erklärt endlich, warum Kalorienzählen und Dauerstress so oft scheitern. Besonders der Satz „Das Körperfett ist nicht das Problem, sondern die Lösung“ sitzt.
Ergänzung aus LCHF-Praxis:
Genau hier schließt sich der Kreis zu LCHF Carb / LCHF / Keto:
– Wenig Insulin → mehr Ketone → Gehirn wird direkt versorgt
– Cortisol legt gezielt Bauchfett an – aber nur, solange KH den Insulinspiegel hochhalten
– In Ketose sinkt der Cortisol-Bedarf → das viszerale Fett schmilzt von selbst
Ein Tipp für alle, die entschlossen starten wollen: Fangt mit 3 Tagen strikt <20g KH an – beobachtet, wie der Heißhunger schwindet und der Schlaf besser wird. Das ist der Moment, wo das Gehirn merkt: „Ah, Ketone! Kein Notfall mehr!“
Viele in der Community berichten: „Seit Keto esse ich mehr Fett, hab weniger Stresshunger – und der Bauch wird flacher, obwohl die Waage kaum runtergeht.“
Das ist Habituation in Aktion – nur mit der richtigen Treibstoffwahl.
Fazit:
Nicht gegen das Gewicht kämpfen, sondern den Stressor (Kohlenhydrate + Dauerlärm) eliminieren – dann reguliert sich der Körper von allein.
Danke, Gnubbel – wieder ein Beitrag, der nicht nur klug macht, sondern auch Mut!
Gnubbel 28. Oktober 2025
Zuerst mal herzlichen Dank, liebe Margret, für das Lob. Ja, das Thema Habituation war auch für mich ein echter Augenöffner, konnte ich doch endlich logisch nachvollziehen, warum die einen unter Dauerstress dick werden und die anderen krank. Auch mit deinem Argumentationsstrang gehe ich d’accord, und ich wünsche jedem von Herzen den Erfolg, den du in Aussicht gestellt hast.
Trotzdem bin ich der Meinung, dass man seine Erwartungen den Realitäten anpassen sollte, die, bedingt durch die Biografie oder die berufliche, familiäre oder finanzielle Situation, mitunter krass vom Ideal abweichen können, wofür ich selbst als lebendiges Beispiel herhalten kann: Ich ernähre mich seit fast zehn Jahren streng LCHF und hatte noch nie das Bedürfnis nach einem „Cheat day“. Fast ebenso lange betreibe ich schon intermittierendes Fasten (16/8, gern kombiniert mit körperlicher Aktivität, da kann kein Hunger aufkommen), wobei ich das gar nicht mehr als solches empfinde, sondern als meinen natürlichen Tagesrhythmus. Und ich habe mein Leben komplett entschleunigt, pflege ein harmonisches Familienleben, habe wieder Freude am Radfahren gefunden, und mein einziger noch verbliebener Stressor ist der Computerbildschirm, wobei ich längst aus dem Alter von Ballerspielen oder anderen aufputschenden Inhalten raus bin. Und von den Horrormeldungen, mit denen uns die Medien 24/7 zuschütten, lasse ich mich schon lange nicht mehr beeindrucken. Und: Ich nehme jede Gelegenheit mit, herzlich zu lachen. Trotzdem habe ich einen BMI von 35, der sich auffällig in der Leibesmitte konzentriert, und ein Arzt, der mich nicht kennt, würde mir sicherlich meine Zukunft in den düstersten Farben malen.
Aaaber! Mein Neutralgewicht ist seitdem um satte 25 Kilo heruntergegangen, sodass ich mich beim Essen nicht zu zügeln brauche, um mein jetziges Gewicht konstant zu halten. Und mein Arzt bescheinigt mir bei jedem Ultraschall, dass es sich tatsächlich um Depotfett im Darmbereich handelt, denn meine Leber ist blitzsauber, und auch die Blutwerte haben sich enorm verbessert. Warum in aller Welt soll ich daran etwas ändern wollen? Ich bin nun mal der Gnubbel, und wenn jemand mit meiner Gürtellänge ein Problem hat, dann darf er es gerne mit nach Hause nehmen, da bin ich gar nicht so.
Also, Leute, stresst euch nicht mit euren Körpermaßen. Wenn euch das Cortisol irgendwann mal eine Apfelfigur beschert hat, die trotz Dauerketose nicht mehr so richtig weggehen will (es ist leider so, dass einmal angelegte Fettzellen zwar schrumpfen, aber nicht mehr verschwinden können), dann grämt euch nicht darüber, sondern genießt die schönen Seiten des Lebens (zum Beispiel das dicke Plus an Gesundheit). Andernfalls wird euch nämlich der Dauerstress immer wieder Cortisol ins Blut pumpen (https://lchf-deutschland.de/energiekannibalismus-wenn-stress-deinen-koerper-zum-selbstverzehr-treibt/#comment-16662), und dann braucht ihr euch nicht zu wundern, wenn die Waage nicht euer Freund werden will.
Nutzt die enorme Freiheit, nicht mehr alle paar Stunden etwas zu essen zu brauchen, weil die Glukose schon wieder alle ist. Lasst euch die fettigsten Leckereien schmecken, dann wird euch die Weizenpampe wie eine Strafe vorkommen. Und vor allem hört auf, euch wegen eurer Gesundheit und eurer Gürtellänge zu stressen, sonst kann das nämlich zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Genießt euer Leben, ihr habt nur das eine.